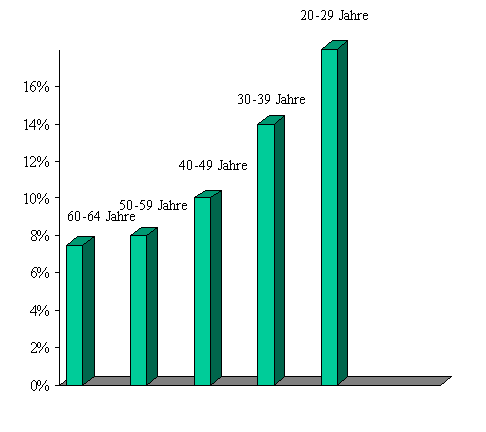
Japan heute und gestern
Ute Roßmann:
Japanische Managementprinzipien
1. Einleitung
Japans wirtschaftliche Entwicklung in der Vergangenheit ist von andauerndem Erfolg gekennzeichnet gewesen. Aus den Trümmern eines verlorenen Krieges mit derart atemberaubender Geschwindigkeit emporgewachsen, konnten sie in erstaunlich vielen Industriezweigen weltweit Führungspositionen erreichen. Ihr Entwicklungsstand weist heute gewaltige Dimensionen auf. Dieser permanente japanische Erfolg gebahr den westlichen Industrienationen traumatische Komplexe. Es lohnt sich deshalb, den Ursachen und mithin dem Geheimnis jenes Erfolges nachzuspüren. Teilweise scheint dies seine Begründung in den japanischen Managementprinzipien zu finden, die wir nun im einzelnen betrachten wollen.
2. Das shushin-koyo-Prinzip
Die japanischen Großunternehmen zeichnen sich durch das besondere Merkmal der Daueranstellung der Stammbelegschaft aus. Die zur Stammbelegschaft zählenden Arbeitnehmer verpflichten sich zur Tätigkeit im Unternehmen zeit ihres Arbeitslebens. Als Äquivalent garantiert das Unternehmen die Zahlung der Löhne und die Beschäftigung (shogai fuyo). Die Erklärung dieses Prinzips der Daueranstellung wird mit dem Hinweis auf das Fortwirken quasi-familiärer Bindungen an das Unternehmen versucht. Anfänglich trifft dies jedoch nur auf die mit dem Unternehmen verwurzelten höheren Angestellten zu (shoku-in). Die Immobilität der Lohnarbeiter (ko-in) wurde dagegen vielmehr erst - im Gegensatz zu einer weit verbreiteten Ansicht - in der zweiten Phase der Industrialisierung installiert, vor allem erst nach dem Ersten Weltkrieg als Antwort auf das damalige Phänomen fühlbar knapper qualifizierter Arbeitskräfte (Fürstenberg (1972), S. 15 f.).
In Anbetracht der Notwendigkeit eines hinreichend geschulten Stammpersonals für die Aufrechterhaltung einer auch qualitativ und dem internationalen Vergleich standhaltenden Produktion waren die Unternehmensleitungen zumindest in der Großindustrie aufgrund der bislang hohen Fluktuationsraten zu einer personalpolitischen Gegensteuerung gezwungen. Zur Erreichung dieses Zweckes griffen sie auf ein in den japanischen Staatsbetrieben und in den alteingesessenen Handelshäusern fortwirkendes patriarchalisches Prinzip zurück, das den Grundsatz der beiderseitigen Verpflichtung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gleichwohl zum Gegenstand hatte.
Die zwischen 1908 und 1918 entstandenen Anfänge des gegenwärtigen Systems der Dauerbeschäftigung basieren auf dieser Grundlage. Seine endgültige Ausformung erhielt jenes Prinzip nach dem Mandschurischen Krieg 1931, als die aus dem Kriegsdienst entlassenen Soldaten mit staatlichem Verdikt vorrangig eingestellt werden mußten.
Die weitreichenden Folgen des Prinzips der Dauerbeschäftigung stehen nunmehr zur Erörterung an. Auf der einen Seite bewirkt die Beschäftigungsgarantie für die Stammbelegschaft eine langfristige Versorgung des Unternehmens mit qualifizierten Arbeitskräften. Mithin sind auch die Arbeitskräfte relativ leicht versetzbar. Zudem gibt es weniger Widerstand gegen notwendige Arbeitsrationalisierungsmaßnahmen, genießen die Arbeitnehmer doch praktisch unbegrenzten Kündigungsschutz. Auf der anderen Seite entsteht aber durch die Immobilität der Stammbelegschaft im Laufe der Jahre ein außerordentlicher Druck auf die höheren Positionen, der - freilich im System begründet - sowohl zur Überbesetzung von Stabspositionen als auch zur Schaffung zahlreicher Aufstiegssurrogate geführt hat (Ohmae (1982), S. 172 ff.).
Als weitere Folge des Systems der Daueranstellung stellt sich die starke Zurückdrängung des Berufsgedankens gegenüber dem Betriebsdenken in den Belegschaften der japanischen Großindustrie heraus. Die Loyalität trifft deshalb nicht eine sich in verschiedenen Sozialbereichen manifestierte Berufsgruppe oder eine bestimmte abstrakte Berufsidee, aus der dann konkrete Regeln für die Berufspraxis herzuleiten wären, sondern sie gilt vermehrt dem Unternehmen als spezifischem japanischen Lebensbereich und der Lebenswelt überhaupt, in die man jahrzehntelang auf Gedeih und Verderb integriert bleibt.
Besonders bemerkenswert ist weiter, daß die japanischen Gewerkschaften das shushin-koyo-Prinzip unterstützen. Der Grund hierfür liegt zweifellos in einem viele Jahrzehnte herrschenden tendenziellen Überangebot an Arbeitskräften. Gegenüber den katastrophalen Lebensbedingungen der Arbeitnehmerschaft etwa um die Jahrhundertwende brachte die Daueranstellung grundlegende große Vorteile, obgleich doch nur für eine privilegierte Arbeitnehmerschicht. Dieses manifestierte sich dann extrem in den 70er und 80er Jahren, wo sogar Aushilfsarbeiter beinahe schon als Stammarbeiter betrachtet wurden (Fürstenberg (1972), S. 19). Mit der nunmehr auch auf Japan übergreifenden Rezession ist es fraglich, wie lange dieses Prinzip von den Unternehmen noch durchgehalten werden kann. Allerdings hat bis jetzt die Rezession im Vergleich zu den Verhältnissen in westlichen Industrieländern kaum Auswirkungen auf die Beschäftigung gezeigt.
3. Das mibun-Prinzip
Der hierarchische Aufbau japanischer Unternehmen begründet sich traditionell im mibun-Prinzip (Statussystem). Die Belegschaften größerer japanischer Unternehmungen wurden bis zum Zweiten Weltkrieg strikt in zwei Gruppen unterteilt mit ganz verschiedenartigen Stellungen: Einmal in shoku-in, was soviel wie Vertrauenspersonen bedeutet. Dieser Begriff wurde immer weiter gefaßt, bis er sich auch auf alle Gehaltsempfänger bzw. Verwaltungsangestellten erstreckte. Zum anderen in ko-in, die Lohnarbeiter. Während sich die shoku-in weitgehend mit der Unternehmung und deren Zielsetzung identifizieren konnten, und sie den Nutzen aus einem von europäischer Sicht her extremen Paternalismus hatten, kristallisierten die ko-in in ihrer großen Masse zu Objekten einer unpersönlichen und teilweise noch wenig humanen Personalverwaltung (Fürstenberg (1972), S. 19 f.).
Das mibun-Prinzip wurde allerdings allmählich immer fragwürdiger. Bedingt durch die Strukturwandlungen im Bereich der Arbeit in Richtung auf eine überproportionale Zunahme der Angestelltentätigkeiten und durch die Anhebung des allgemeinen Bildungsniveaus kam es zu Nivellierungstendenzen, die durch den Zweiten Weltkrieg noch verstärkt wurden. So wurden 1941 die allgemeinen Arbeitsbedingungen für shoku-in und ko-in in den Großunternehmungen mittels Verordnung identisch geregelt. Die Statusunterscheidungen verloren zunehmend an Bedeutung. In der Nachkriegszeit entwickelte sich in vielen Großbetrieben eine weitere Abweichung von diesem Prinzip, denn nunmehr waren das Bildungsniveau und das Dienstalter (shikaku-seido) die Grundlagen der Qualifikation. Anstelle differenzierter Mitarbeiterbezeichnungen setzte man die allgemeine Bezeichnung "sha-in" (Unternehmensangehöriger). Dabei liegt aus japanischem Blickwinkel die Betonung auf einem Unternehmen, das nichts anderes ist als eine Ansammlung von Menschen, von denen jeder einzelne als Mitglied des Unternehmens gilt (Ohmae 1982), S. 171).
Die kontinuierliche Anhebung der Schulbildung ließ auch dieses System bald überkommen. In den modernsten Unternehmen setzte sich im Zuge dessen zögerlich das Prinzip der Qualifikation nach den betrieblichen Funktionen durch, wobei oft jedoch daneben die alte Statusorganisation bestehen blieb, was gerade bei Ausländern mitunter zu einiger Verwirrung führt.
4. Das nenko-joretsu-Prinzip
Das zwar gelockerte, aber als Leitbild noch nicht abgelöste Prinzip der Beschäftigung auf die Dauer des Arbeitslebens in der gleichen Firma ist eng gekoppelt mit dem Senioritätsprinzip, also das nenko-joretsu. Entscheidender Maßstab für die Stellung des Menschen im Unternehmen, für den Umfang seiner Rechte und das Wie seiner Behandlung ist in Japan immer noch die Dauer der Betriebszugehörigkeit. Dies kommt besonders deutlich im Entlohnungs- und Beförderungssystem zum Ausdruck. In der japanischen Industrie erfolgt die Entlohnung hauptsächlich nach dem Schulbildungsstand, dem Dienst- und dem Lebensalter. Zu dem Monatslohn kommen zwar regelmäßig zahlreiche Zuschläge, doch berücksichtigen diese aber nur zum Teil die individuelle Leistung. So muß die Kausa des Lohnanreizes in der japanischen Großindustrie in erster Linie in der Belohnung für das Dienstalter bzw. für den längerfristigen Leistungsbeitrag des Individuums gesehen werden. Der Anreiz wirkt also mit Blick auf eine zu erbringende Leistung indirekt und langfristig, er wirkt also weniger individualistisch als an das Gruppenniveau angleichend (Vaubel (1986), S. 99). Vor diesem Hintergrund treten auch die Schwierigkeiten hervor, die in der japanischen Großindustrie mit der Einführung der Systeme des Leistungslohns und der Arbeitsbewertung nach westlichem Muster verbunden sind.
Auch für die Beförderung ist die Länge des Dienstalters entscheidend. In regelmäßigen Intervallen rückt der japanische Mitarbeiter innerhalb der Statushierarchie auf als Voraussetzung für den Erhalt von Aufstiegschancen im Bereich der Funktionshierarchie. Im Zusammenhang mit dem Prinzip der Daueranstellung ergibt sich hieraus zwingend die Notwendigkeit, die Laufbahn auf ein einziges Unternehmen zu beschränken. Von daher rührt es, daß nur wenige Führungskräfte in den japanischen Großunternehmen im Rahmen zwischenbetrieblicher Mobilität aufsteigen konnten.
5. Das teinen-Prinzip
Der Grundsatz der Zwangspensionierung bei Erreichen einer relativ niedrigen Altersgrenze von 55 bis 57 Jahren (teinen-seido) ist überliefert. Mit der Einführung des Prinzips der Daueranstellung übernahm die japanische Großindustrie zudem den Grundsatz der Frühpensionierung als Regulativ zu der übernommenen Verpflichtung, auch leistungsschwachen Personen nicht zu kündigen. Der genannte Grundsatz bringt deshalb ein vergleichsweises geringes Durchschnittsalter japanischer Belegschaften mit sich. Dies gilt jedoch nur für die Rangstufen bis zum Prokuristen. Wer dieses Beförderungsziel bis zum 40. Lebensjahr nicht erreicht hat, wird in aller Regel zwischen dem 55. und 57. Lebensjahr bei Zahlung einer Abfindungssumme, die einem Monatsgehalt für jedes Dienstjahr entspricht, zwangspensioniert.
Den leitenden Angestellten hingegen ist es möglich, noch einige Jahre länger im Unternehmen tätig zu sein. Oft besteht die Gelegenheit der zeitweisen Weiterbeschäftigung in Tochtergesellschaften nach der Zwangspensionierung (shoku-taku). Diese Praxis der Entlassung der Mitarbeiter bei Erreichen der Altersgrenze und gleichzeitiger Neueinstellung bei zwar vermindertem Gehalt und etwas veränderten Arbeitsbedingungen zeigt in aller Deutlichkeit die Entlastungsfunktion des Prinzips der Frühpensionierung gegenüber den sich aus der Garantie der Daueranstellung ergebenden Verpflichtungen (Fürstenberg (1972), S. 23).
6. Das ringi-Prinzip
Der für den Europäer bemerkenswerte und zugleich merkwürdigste japanische Betriebsführungsgrundsatz ist durch einen eigentümlichen Entscheidungsprozeß gekennzeichnet (ringi-System). Hierbei stellt sich die Frage, worin eigentlich die verantwortliche Tätigkeit eines Vorgesetzten besteht. In seinem Vorstellungsvermögen sieht man sich einem reifen, würdigen Herrn gegenüber, man sieht ihn, wie er einen Bericht studiert, wie er ihm ein paar Bemerkungen hinzufügt und wie er ihn dann mit seinem persönlichen Siegel versieht. Welches Arbeitssystem verbirgt sich nun hinter dieser Tätigkeit und wie arbeitet es (Noda (1964), S. 162)?
Es erfolgt die Ausarbeitung eines Planes bzw. eines Vorschlages von einer Stelle der mittleren Betriebsführung aus. Die Ausarbeitung wird in jedem Falle von dort vorgenommen, auch wenn die Anregung von unterhalb oder oberhalb dieser Bereichsschicht ausgeht.
Bevor der Plan zu höheren Vorgesetzten gelangt, rotiert er in den beteiligten Sachgebietsbereichen der mittleren Führungsebene. Dort werden gegebenenfalls aufgrund von Spezialermittlungen Zusätze und Veränderungen angebracht. Gelegentlich wird der Plan auch erörtert.
Die Zustimmung zu dem erarbeiteten Plan ist nicht von einer bestimmten Stelle abhängig, sondern sie geschieht vielmehr auf dem Wege einer häufig formal vorgeschriebenen Reihenfolge zu den verschiedenen hierarchischen Ebenen.
Letztendlich muß in vielen Unternehmen der Generaldirektor dem Plan in seiner erarbeiteten Form seine Zustimmung erteilen. Der zwischenzeitlich ein Dutzend oder mehr Siegel tragende Plan läßt so die individuelle Verantwortlichkeit schwerlich abgrenzen. Nach der Zustimmung wird dessen Inhalt mittels einer Weisung an die Führungskraft zurückgereicht, die ihn ursprünglich entworfen und vorgelegt hat.
Betrachtet man diesen Entscheidungsweg, könnte man der Idee verfallen, in den das ringi-System anwendenden japanischen Unternehmungen herrsche ein absoluter Zentralismus verbunden mit einer totalen Bürokratisierung, die eine völlige Auflösung von Verantwortlichkeit mit sich zieht. Reflektiert man aber, daß Entscheidungen auf der mittleren Betriebsebene geplant und durchgeführt werden, so gibt dies doch dem betreffenden Personenkreis ein erhebliches Gewicht. Hinzu kommt, daß an dem Zustandekommen der maßgeblichen Entscheidung alle Betroffenen beteiligt sind, wodurch ihr besonderer Nachdruck verliehen wird und wodurch Obstruktionen weitestgehend verhindert werden. Es handelt sich also bei Entscheidungen nach dem ringi-System um Gruppenentscheidungen, die in Anbetracht der komplexen Arbeitswirklichkeit und im Blick auf vorliegende moderne betriebssoziologische Erkenntnisse keineswegs irrelevant und ohne Substanz sind. Es wird zwar noch das Entscheidungsrelevante zur endgültigen Absegnung dem Generaldirektor vorgelegt, dieser gibt jedoch sein Siegel und seine Zustimmung nur rein formal, indem er sich lediglich vergewissert, daß alle sachlich Beteiligten ihre erforderliche Genehmigung gegengezeichnet haben (Fürstenberg (1972), S. 25).
7. Aktuelle Entwicklungen
Allerdings werden mittlerweile die traditionellen Managementprinzipien zum Teil in Frage gestellt. Es handelt sich insbesondere um die Beförderung nach dem Dienstalter (nenko-joretsu) und um die Beschäftigung auf Lebenszeit (shushin-koyo). Dabei ist bemerkenswert, daß die Zweifel an der Richtigkeit der Managementprinzipien nicht nur von Arbeitgeberseite ausgehen (Hori (1993), S. 165 ff.), die nun in der Rezession nach Möglichkeiten von Leistungsanreizen und der Kostendämpfung sucht. Gerade unter jüngeren Arbeitnehmern scheint das Loyalitätsbewußtsein gegenüber der "kaisha" abzunehmen und damit der Wunsch nach Veränderung zuzunehmen (vgl. Abb. 1).
Abb. 1: Loyalität gegenüber der Firma
Prozent der Nein-Antworten (nicht loyal)
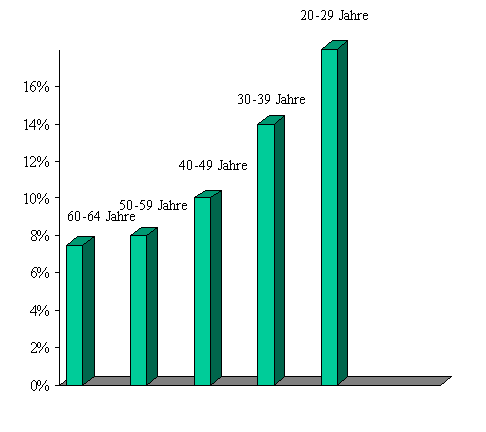
Option Poll on Work
Attitudes, Survey 1992
Gründe hierfür scheinen vor allem darin zu liegen, daß jüngere Arbeitnehmer das eigene Familienleben höher bewerten. Folge davon ist, daß auch in Japan Arbeit eventuell verstärkt als ein "Ungut" betrachtet wird, für dessen Angebotserhöhung auch mehr gezahlt werden muß (vgl. Abb. 2).
Abb. 2: Gründe für das Fühlen fehlender Loyalität
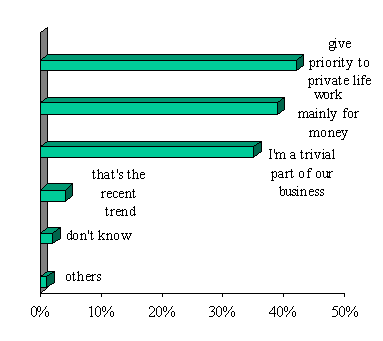
Option Poll on Work Attitudes, Survey 1992
Wie schnell allerdings ein Wechsel einsetzen wird, bleibt bei der Traditionsverbundenheit der Japaner abzuwarten. Jedenfalls scheint die Richtung des Trends unzweifelhaft festzustehen.
Literaturverzeichnis:
Abegglen, J. und G. Stalk. 1985. KAISHA - Das Geheimnis des japanischen Erfolges. New York.
Fürstenberg, F. 1972. Japanische Unternehmensführung. Zürich.
Hori, S. 1993. "Fixing Japan's White-Collar Economy: A Personal View". In: Harvard Business Review, 11/12: 157-172.
Noda, K. 1964. "Japan's Industrialization and Entrepreneurship". In: Oyo Shakaigaku Kenkyu, Heft 7.
Ohmae, K. 1982. The Mind of the Strategist - the Art of Japanese Business. London.